|
"Berlin hat es nötig: ein Zukunftsbild, ein Ziel, eine Vision!"
 Mit
einer Briefkasten-Aktion auf dem diesjährigen Umweltfestival am Brandenburger Tor startete
das Agendaforum den stadtweiten Dialog über den Entwurf der gesamtstädtischen Agenda, das
Zukunftsprogramm für Berlin. Mit
einer Briefkasten-Aktion auf dem diesjährigen Umweltfestival am Brandenburger Tor startete
das Agendaforum den stadtweiten Dialog über den Entwurf der gesamtstädtischen Agenda, das
Zukunftsprogramm für Berlin.
Verbraucherministerin Renate Künast, die das Umweltfestival eröffnete, erklärte,
dass sie sich als Wa(h)l-Berlinerin ganz besonders freue, dass der Agendaprozess in Berlin Fuß
gefasst hat, "denn Berlin hat es nötig: ein Zukunftsbild, ein Ziel, eine Vision!".
Die Besucher des Umweltfestivals forderte die Ministerin dazu auf, den grasgrünen Briefkasten
der Lokalen Agenda 21 Berlin mit Vorschlägen für ein zukunftstaugliches Berlin zu füllen:
"Ich kann Sie nur ermutigen: Beteiligen Sie sich an der Agendakamapagne, die heute hier
beginnt! Ich wünsche der Berliner Agendakampagne eine rege Beteiligung und einen fruchtbaren
Diskussionsprozess. Alles, alles Gute!"
  Ähnlich
äußerte sich auch der DGB-Landesvorsitzende Dieter Scholz: "Ich find´s super,
dass sich Menschen in der Stadt gefunden haben, die sagen, ‚wir machen jetzt Feuer unter
diesen Topf’, und ich hoffe, dass der Agendaprozess hier heute die notwendige
Initialzündung bekommt." Ähnlich
äußerte sich auch der DGB-Landesvorsitzende Dieter Scholz: "Ich find´s super,
dass sich Menschen in der Stadt gefunden haben, die sagen, ‚wir machen jetzt Feuer unter
diesen Topf’, und ich hoffe, dass der Agendaprozess hier heute die notwendige
Initialzündung bekommt."
In der Talkrunde mit der RBB-Moderatorin Carla Kniestedt auf der Bühne des
Umweltfestivals erklärte Dieter Scholz weiter: "Für uns als Gewerkschafter sind die Themen
der Lokalen Agenda: soziale Gerechtigkeit, Umweltschutz oder Bildung Grundthemen, weil sie alle
auch mit der Zukunft der Arbeit zu tun haben. Und deswegen unterstützen wir diesen Prozess."
Stefan Richter von der GRÜNEN LIGA erläuterte den Besuchern des
Umweltfestivals das Besondere des Agendaprozesses: dass nicht Politik und Verwaltung (allein),
sondern interessierte Bürger durch ihre Vorschläge (mit)bestimmen, wie die Zukunft aussehen soll.
Hilla Metzner aus dem Fachforum Bildung machte exemplarisch deutlich, worum es
in dem Entwurf eines Zukunftsprogramms für Berlin u. a. geht: "Bildung für eine
nachhaltige Entwicklung, da fragen viele Leute: Was ist denn das? Es wird ja schon viel
Umweltpädagogik gemacht, was ist denn das besondere daran? Bildung für eine nachhaltige
Entwicklung bedeutet zum einen, dass Kinder und Jugendliche möglichst früh Partizipation
lernen, in ihrer Gemeinde, in ihrem Umfeld und in der Schule. Und dass sie möglichst viel in
Zusammenhängen denken lernen, z. B. lernen, wie begrenzt unsere Rohstoffe sind, und dass
sie lernen, sich nicht nur lokal zu engagieren, sondern auch ein bisschen global zu denken."
In seinem Beitrag für eine nachhaltige Bildung im Zukunftsprogramm für Berlin fordert das
Fachforum Bildung deshalb auch, das Thema Nachhaltigkeit als eine "ethische Wertung, die
über den anderen Aufgabenfeldern steht", in das Schulgesetz und in die Rahmenpläne
aufzunehmen.
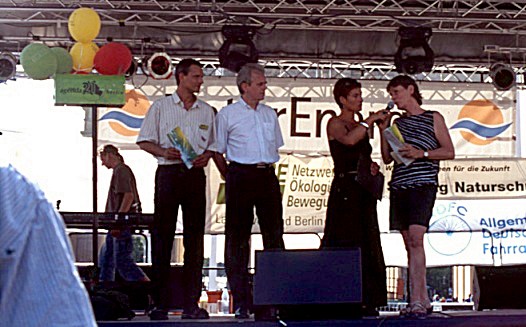
Auftaktaktion auf dem Umweltfestival mit dem Zukunftsbriefkasten (v. l. n. r.):
Stefan Richter (Grüne Liga), Dieter Scholz (DGB), Carla Kniestedt (RBB) und Hilla Metzner
(Fachforum Bildung)
Nach dem Talk auf der Bühne waren die Besucher des Umweltfestivals eingeladen, ihrerseits
Vorstellungen und Vorschläge für ein umwelt-, wirtschafts- und sozialverträgliches Leben in der
Stadt in in den Zukunftsbriefkasten einzuwerfen. "Hier kannst Du dich einbringen",
lautete die Aufschrift auf dem grünen Briefkasten, und viele folgten dieser Aufforderung.
Dabei reichten die Wünsche für die Zukunft von kostenloser Fahrradmitnahme bei der
BVG-Standard-Monatskarte bis hin zu weniger berlin-spezifischen Forderungen wie die des
Verbotes von gen-manipulierten Produkten.
 Am
Stand der Berlin-Agenda fanden sich weitere Prominente ein. Werner Schenkel, bis Anfang
des Jahres Erster Direktor des Umweltbundesamtes, forderte in seinem Zukunftsbrief vom
Berliner Senat nicht nur die "schnelle Verwirklichung des vorliegenden Abfallkonzeptes"
und mit Hinweis darauf, dass Berlin einmal das Mekka umweltpolitischer Bewegungen war, auch
"eine verstärkte Unterstützung von Umweltlehre und -forschung an den Berliner Hochschulen".
Als Privatmann und Jogger, der durch die allgegenwärtigen Häufchen seine Lebensqualität
beeinträchtig sieht: "die Durchsetzung der Hundekotverordnung". Am
Stand der Berlin-Agenda fanden sich weitere Prominente ein. Werner Schenkel, bis Anfang
des Jahres Erster Direktor des Umweltbundesamtes, forderte in seinem Zukunftsbrief vom
Berliner Senat nicht nur die "schnelle Verwirklichung des vorliegenden Abfallkonzeptes"
und mit Hinweis darauf, dass Berlin einmal das Mekka umweltpolitischer Bewegungen war, auch
"eine verstärkte Unterstützung von Umweltlehre und -forschung an den Berliner Hochschulen".
Als Privatmann und Jogger, der durch die allgegenwärtigen Häufchen seine Lebensqualität
beeinträchtig sieht: "die Durchsetzung der Hundekotverordnung".
  Heinrich
Freiherr von Lersner, UBA-Präsident a. D., forderte: "Der Senat
möge sich im Bundesrat für die Erhöhung der Mittel für umweltrelevante Entwicklungshilfe
einsetzen." Der Entwicklungsetat müsse heutzutage höher sein als der des
Verteidigungsministers, denn "durch die Klimageschichte wissen wir ja, dass der
Umweltschutz ein globales Problem ist und dass überall in der Welt etwas getan werden muss, um
mit diesem Problem fertig zu werden." Heinrich
Freiherr von Lersner, UBA-Präsident a. D., forderte: "Der Senat
möge sich im Bundesrat für die Erhöhung der Mittel für umweltrelevante Entwicklungshilfe
einsetzen." Der Entwicklungsetat müsse heutzutage höher sein als der des
Verteidigungsministers, denn "durch die Klimageschichte wissen wir ja, dass der
Umweltschutz ein globales Problem ist und dass überall in der Welt etwas getan werden muss, um
mit diesem Problem fertig zu werden."
Im Interview räumte Freiherr von Lersner ein, dass der Gedanke des "global denken, lokal
handeln" schwer zu vermitteln sei: "Uns fehlt da bisher die Katastrophe - die
Klimakatastrophe ist in Deutschland nun mal nicht sichtbar. Im Umweltschutz haben bisher immer
Katastrophen den Anstoß für Veränderungen gegeben: Was haben wir erreicht durch Seveso oder
Brent Spar oder das Seehundsterben. Wenn Brigitte Bardot mit einem gestorbenen Seehund am Busen
im Fernsehen war, dann haben die Bonner Politiker gesagt: Wir müssen mal was in der Nordsee tun."
Obwohl sich Umweltschutz und wirtschaftliche Entwicklung keineswegs ausschließen müssen, so
Freiherr von Lersner, bestehen zwischen Ökonomie und Ökologie oft Zeitkonflikte: "Nehmen wir
die Sonnen- oder die Windenergie, die rechnet sich auch ökonomisch, aber in längeren Zeiträumen;
klassische Ökonomen denken aber in höchstens 10-Jahreszeiträumen."
 Michael
Zschiesche vom Unabhängigen Institut für Umweltfragen (UfU) trat mit seinem
Beispiel, dem Projekt "Fifty-fifty" zur Energieeinsparung an Schulen, den Beweis dafür
an, wie ganz im Sinne der Agenda 21 Lösungen gefunden werden können, die ökonomisch und
ökologisch Sinn machen und noch dazu sozial sind: "Zur Zeit sind die Schulen dabei, durch
einfache Energiesparmaßnahmen ungefähr 1 Mio. Euro im Jahr einzusparen. Von dem
eingesparten Geld bekommt 50 % die Schule, die das Geld in eine bessere Ausstattung stecken
kann, und 50 % das Land Berlin zum Auffüllen seiner leeren Kassen. Insgesamt liegt das
Sparpotential - nur auf Schulen bezogen - bei 6 Mio. Euro. Wenn man mehr von
diesen Maßnahmen machen würde, in allen öffentlichen Gebäuden, kämen enorme Summen dabei
heraus. Leider ist das Ganze auf der politischen Ebene zwar gewollt, aber auf der
Umsetzungsebene hapert es." Michael
Zschiesche vom Unabhängigen Institut für Umweltfragen (UfU) trat mit seinem
Beispiel, dem Projekt "Fifty-fifty" zur Energieeinsparung an Schulen, den Beweis dafür
an, wie ganz im Sinne der Agenda 21 Lösungen gefunden werden können, die ökonomisch und
ökologisch Sinn machen und noch dazu sozial sind: "Zur Zeit sind die Schulen dabei, durch
einfache Energiesparmaßnahmen ungefähr 1 Mio. Euro im Jahr einzusparen. Von dem
eingesparten Geld bekommt 50 % die Schule, die das Geld in eine bessere Ausstattung stecken
kann, und 50 % das Land Berlin zum Auffüllen seiner leeren Kassen. Insgesamt liegt das
Sparpotential - nur auf Schulen bezogen - bei 6 Mio. Euro. Wenn man mehr von
diesen Maßnahmen machen würde, in allen öffentlichen Gebäuden, kämen enorme Summen dabei
heraus. Leider ist das Ganze auf der politischen Ebene zwar gewollt, aber auf der
Umsetzungsebene hapert es."
In den kommenden Wochen und Monaten wird der Zukunftsbriefkasten auf Straßen, Plätzen oder
in öffentlichen Gebäuden immer wieder auftauchen. Auch per Briefpost, per E-Mail auf der
Website des Agendaforums und bei den Veranstaltungen
im Roten Rathaus und in den Bezirken haben Berliner Bürger die Möglichkeit, sich in den
Agendaprozess "einzubringen".
Heide Wohlers
aha - Büro für nachhaltige und kreative Kommunikation
im Auftrag des Agendaforums
Zum Agendaentwurf und dem virtuellen Briefkasten
|